Heute liegt nur die Wochenendzeitung auf dem Kassenband, was auch der Kassiererin direkt auffällt – sie spricht mich darauf an. Man kennt sich durch den schon öfters geführten Smalltalk, plaudert kurz, Zahlungsvorgang abgewickelt, freundliche Verabschiedung und schon ziehe ich mit der Zeitung unterm Arm davon. Ob sie selbst noch gedruckte Zeitungen liest oder längst alle Informationen über ihr Smartphone konsumiert, weiß ich nicht, aber dennoch ist die Überlegung angebracht. Immerhin sind wir etwa im gleichen Alter und gerade jüngere Menschen verlieren zunehmend den Bezug zur gedruckten Zeitung beziehungsweise allgemein zu Printmedien. Wer heute keine gedruckten Zeitungen mehr liest, wird es auch mit steigendem Alter vermutlich nicht tun. Dabei ist die Reichweite bei der Zielgruppe 14-29 Jahre gar nicht schlecht: Die digitalen Angebote der Tageszeitungen erreichen 62,4 Prozent dieser Internetnutzerschaft. Gleichzeitig kommt die Analyse zum Ergebnis, dass immerhin 7,1 Millionen Menschen dieser Zielgruppe regelmäßig eine gedruckte Zeitung lesen (Reichweite 48,1 Prozent), was den deutschen Zeitungsmarkt aber gewiss nicht aufatmen lassen kann.[1]
Schließlich wird die zunehmende Digitalisierung des Medienkonsums nicht zum Überleben der gedruckten Zeitungen beitragen – ganz im Gegenteil. Smartphones werden immer günstiger, leichter und unkomplizierter, sodass sie auch verstärkt für ältere Generationen interessant werden. Wie sich der deutsche Zeitungsmarkt zukünftig entwickeln wird, weiß niemand so genau, wenngleich sich eindeutig der Trend zu Onlinenachrichten abzeichnet. Und an dieser Form des Nachrichtenkonsums erfreuen sich zunehmend eben nicht nur jüngere Menschen. Zwar lesen Personen über 40 – also die sogenannten digitalen Immigranten – noch relativ häufig gedruckte Zeitungen, wenngleich auch ihr Interesse an Smartphones und Tablets zunimmt.
Der Journalistik-Professor Klaus Meier hat im Frühling 2012 bereits die Vermutung aufgestellt, dass in Deutschland spätestens 2034 die letzte Tageszeitung gedruckt wird. Das sagen zumindest seine Errechnungen, die auf den Auflagen-Entwicklungen deutscher Tageszeitungen seit 1992 beruhen.[2]
Ob die gedruckte Zeitung in rund zwanzig Jahren also tatsächlich aussterben wird, bleibt ungewiss. Mindestens genauso ungewiss wie die Entwicklung unabhängigen Journalismus und seiner Finanzierung. Den Zeitungen geht es schlecht, klagen die Verlegerinnen und Verleger, was schließlich auch nicht so einfach von der Hand zu weisen ist. Die Financial Times Deutschland stellte mit ihrer Ausgabe am 07. Dezember letzten Jahres den Betrieb ein und fast zur gleichen Zeit stellte die Frankfurter Rundschau beim Amtsgericht Frankfurt einen Antrag auf Einleitung des Insolvenzverfahrens. Zwar gehört die Rundschau nun dem FAZ-Verlag an und kann mit abgespeckter Redaktion weitermachen, wenngleich diese beiden Geschichten Symbolcharakter für die gesamte Zeitungsbranche haben und mit ihnen die Debatte um die Zeitungskrise erneut aufflammte.
„Wenn das Totenglöcklein bimmelt“ titelte die Stuttgarter Wochenzeitung Kontext: und stellte fest, dass die Tageszeitung, so wie wir sie kennen, seit über 150 Jahren existent ist. Das ist schon erstaunlich, immerhin haben Tageszeitungen sogar das Fernsehen überlebt. Ob sie das Internet überleben werden, bleibt weiter ungewiss.[3] Die Verlage gehen mit der aktuell vorherrschenden Zeitungskrise ganz unterschiedlich um und wenden verschiedene Mittel an. Bislang zeichnet sich dabei kein wirkliches Erfolgsrezept ab, sodass unter VerlegerInnen und JournalistInnen die Angst zunehmend größer wird. Diese Panik hat spätestens mit dem Verkauf mehrerer Blätter des Springer-Verlags ihren derzeitigen Höhepunkt erreicht. Sollte das Kartellamt zustimmen, verkauft Springer zum Jahreswechsel neben dem Hamburger Abendblatt die Berliner Morgenpost und alle ihre Programm- und Frauenzeitschriften (z.B. Hörzu, Bild der Frau) an die Funke-Mediengruppe. Der Deal bringt dem börsennotierten Unternehmen 920 Millionen Euro ein, was angesichts der Zeitungskrise eine stolze Summe ist.[4] Vermutlich hätte der Verlag zu einem späteren Zeitpunkt weniger für die ganzen Titel erhalten.
Springer-Chef Mathias Döpfner hat unterschiedliche Kritiken für seinen Mediendeal erhalten: Die eine Seite lobt ihn für diesen gewinnbringenden Verkauf und den damit weiter geebneten Weg des Onlinejournalismus, die andere Seite zeigt sich entsetzt und übt scharfe Kritik. „Dem Springer-Verlag fehlen Ideen und Visionen“, war vor rund einem Monat auf Spiegel Online zu lesen. Schließlich würde sich der Verlag damit selbst entkernen und nicht mehr daran glauben, dass sich mit Journalismus noch Geld verdienen ließe.[5] Andere namhafte Zeitungen waren ähnlicher Meinung. Das offenbart indirekt die Angst, die sich im Umfeld der Zeitungen breit macht. Eigentlich wissen sie alle, dass Mathias Döpfner recht haben könnte. Die Zukunft der gedruckten Zeitung ist ungewiss und damit auch die Existenz von vielen Menschen. Klar, da spielt man die Brisanz lieber etwas herunter.
Der Springer-Verlag wird mit diesem Ausverkauf nicht komplett aus dem Printgeschäft aussteigen, immerhin bleiben zum Beispiel die Aushängeschilder Bild und Welt weiterhin in eigener Hand. Aber Döpfner traut sich den Schritt zu mehr Onlineinhalten, weil er darin mehr Sinn und die Zukunft der Nachrichten vermutet. Der Trend gibt ihm recht, was aber keine Garantie für solide Umsätze implizieren muss.
Nach wie vor gibt es kein funktionierendes Finanzierungsmodell für digitale Nachrichten, sodass mit solchen Inhalten nicht einmal kostendeckend gewirtschaftet werden kann. Viele Zeitungen zahlen für ihre Onlineauftritte drauf – doch ohne Internet geht es natürlich auch nicht. Dann ist die Leserschaft verärgert, schließlich erwartet sie jederzeit verfügbare und gut recherchierte Artikel. Kostenlos natürlich. Deshalb setzt ein Teil der Verlage auf Onlinewerbung, die teilweise beim Lesen der Texte stört und nicht ansatzweise ausreichend Geld einbringt. Mit dieser Form von Werbung kann eine Zeitung im Netz nicht ausreichend finanziert werden. Das wissen alle, weshalb sogenannte Bezahlschranken immer häufiger ihre Verwendung finden. Doch diese schränken den Informationsfluss ein, weil nicht zahlende NutzerInnen somit nur noch auf ein beschränktes Kontingent an Artikeln zugreifen können oder ihnen alles verwehrt bleibt. Gerade in Zeiten der Kostenlos-Mentalität, die erst durch das Internet stark gewachsen ist, funktionieren solche Finanzierungsmodelle nur bedingt.
Die taz hat deshalb eine Art freiwillige Bezahlschranke entwickelt: Man bekommt einen Hinweis, der zum Zahlen ermutigen soll, aber ansonsten sind alle Texte kostenlos und jederzeit verfügbar. Dieses Zahlungsmodell basiert darauf, dass alle LeserInnen für einen Artikel ihrer Wahl freiwillig bezahlen können. Und das funktioniert, zumindest besser. Das Modell nennt sich taz-zahl-ich und erwirtschaftete alleine im vergangenen Juni 10.216,89 Euro, was sicherlich kein schlechten Erlös darstellt, aber längst nicht zur Deckung sämtlicher Kosten reicht, die so ein Onlineauftritt mit sich bringt. Die Zeitung selbst beziffert die Kosten für die Seite im Jahr 2010 auf gut 600.000 Euro, wobei durch Werbeeinnahmen nur rund 235.000 Euro eingenommen werden konnten. Das ergibt einen Verlust von 365.000 Euro, die dann einfach fehlen. Bei der Annahme, dass jeden Monat 10.000 Euro freiwillig gezahlt werden, würde sich am Jahresende eine Spendensumme von 120.000 Euro ergeben. Das reicht eben auch nicht. Damit also eine solche freiwillige Finanzierungsmethode wirtschaftlich wird, müssten drei bis viermal so viele Spenden getätigt werden. Es ist also ein sinnvoller Ansatz, der die Nutzungsmöglichkeiten nicht einschränkt und gleichzeitig der Leserschaft die Möglichkeit gibt, Artikel zu honorieren, die einem gut gefallen.
Die gedruckte Zeitung lässt sich eben nicht identisch auf das Internet übertragen. Einst waren Zeitungen wahre Gelddruckmaschinen und namhafte Titel eine Garantie für hohe Gewinne. Auf dieser Tatsache hat sich die Verlagslandschaft zu lange ausgeruht und den medialen Wandel – bewusst oder unbewusst – verschlafen. Viel zu spät wurden Überlegungen angestellt, wie sich digitale Zeitungen ernsthaft finanzieren lassen und die Leute zum Bezahlen solcher Inhalte motiviert werden können. Aus der Not heraus kamen dann beispielsweise die eben erwähnten Bezahlschranken.
Es ist aber nicht ausschließlich die Schuld von Leserinnen und Lesern, sondern liegt ein Teil der Schuld auch bei den Verlagen. Die meisten Zeitungstitel liegen in den Händen weniger Verlagsgruppen, sodass wirkliche Unterschiede bei der Aufmachung und dem Inhalt nicht länger gegeben sind. Längst ist es gängige Praxis, dass Redaktionen verkleinert, zusammengelegt oder durch freie MitarbeiterInnen ausgetauscht werden. Das passiert auch beim aktuellen Deal zwischen Springer und Funke: Demnach wird die Welt den Mantel für diverse Zeitungen (Westdeutsche Allgemeine Zeitung, Westfalenpost, Neue Ruhr/Neue Rhein-Zeitung, Westfälische Rundschau und Hamburger Abendblatt) der Funke-Mediengruppe liefern. Es bleibt fraglich, ob es den Leserinnen und Lesern gefällt, wenn der Mantelteil plötzlich aus Berlin kommt.[6]
Es ist doch also kein Wunder, wenn die Zahlen der Abonnements sinken. Wo bleibt die Unabhängigkeit, die Eigenständigkeit, der eigene Charakter einer Zeitung? Die gleiche Meinungsmache in etlichen Zeitungen bietet eben keinen ernsthaften Mehrwert für die Leserschaft. Hinzu kommt, dass vielen Redaktionen die Mittel fehlen, um investigativen Journalismus betreiben zu können.
Nichtsdestotrotz zeigen die taz oder der Freitag, dass es auch anders funktionieren kann. Nicht nur das freiwillige Bezahlsystem der taz ist vorbildlich, auch die Verpixelung von Sportwerbung ist einzigartig.[7] Darüber hinaus hat die Zeitung tatsächlich noch eine Perspektive – selbst gedruckt. Ihr ist es gelungen, die Gesamtauflage stabil zu halten und bei der Wochenendausgabe deutliche Zuwächse erzielen zu können. Sie ist dabei die einzige überregionale Tageszeitung, deren Auflage gegenüber dem Vorjahresquartal nicht fiel, sondern sogar minimal anstieg. Die Konkurrenz kann da nur neidisch zusehen, immerhin haben sie alle mit teils dramatischen Auflagenrückgängen zu kämpfen.[8]
Der Wochenzeitung der Freitag geht es auch nicht sonderlich gut, wenngleich sie gerade bei ihrem Onlineauftritt neue Akzente gesetzt hat. Die angezeigte Werbung lässt sich mit einem einzigen Klick ausstellen, was im Zuge der Debatte um funktionierende Internetwerbung eingeführt wurde. Solange es keine Werbeform gibt, die nicht beim Lesen von Texten stört, kann nervige Werbung temporär einfach abgestellt werden. Das ist ein fairer Kompromiss, der in der Zeitungslandschaft Vorbildcharakter hat.[9] Zudem können UserInnen selbst Artikel schreiben und diese in der Onlineausgabe publizieren.
Die einen wollen also schnell weg von der gedruckten Zeitung und endlich Geld mit dem Internet verdienen, die anderen hingegen möchten gar nicht so gerne im Internet publizieren, sondern die gedruckte Zeitung fortführen. Beides ist schwierig und funktioniert so nicht automatisch.
Journalismus muss neu gedacht werden, immerhin ist dieser in einer funktionierenden Demokratie unverzichtbar. Er muss kritisch betrachten, Inhalte aufdecken, öffentlich machen und zur Meinungsbildung in der Gesellschaft beitragen. Außerdem braucht es wieder verstärkt Vielfalt in der Zeitungslandschaft, die durch wenige Verlage nicht gewährleistet ist.
Anschließend müssen auch die LeserInnen wieder ein Gespür dafür entwickeln, dass Journalismus nicht umsonst ist und irgendwie finanziert werden muss. Das kann durch Solidaritätsabos, freiwilliges Bezahlen oder ähnliche faire Modelle erfolgen. Aber es muss passieren, weil es sonst für die Zeitungen eng wird.
Es geht zugleich aber auch um die Frage, wie Informationen transportiert und konsumiert werden. Eine gedruckte Zeitung bietet facettenreiche Texte in einer Ausgabe gebündelt und lässt sich erheblich angenehmer lesen, sodass sie einen
unvergleichlichen Charakter ausstrahlt. Die Leserschaft taucht dabei für einen Moment in eine ganz andere Welt ab, weit entfernt vom Internet und kühl wirkenden Displays. Printausgaben haben – ähnlich wie Bücher – einen unverwechselbaren Charme, der das Lesen angenehm und besonders macht. Tagesthemen lassen sich zukünftig nur über das Internet sinnvoll
verteilen, wenngleich für alle Texte darüber hinaus Printmedien wertvoll und zu erhalten sind. Schließlich werden auch Armbanduhren verkauft, obwohl an nahezu jeder Ecke die Uhrzeit nachgesehen werden kann – so verhält es sich eben auch bei der gedruckten Zeitung. Die Tageszeitung darf – abgesehen vom Onlineangebot – zukünftig aber nicht mehr Nachrichten wiedergeben, sondern muss sie zu bestimmten Ereignissen Meinungen, Hintergrundrecherchen, Kommentare und Ideen
liefern. Solche Inhalte sind auch am nächsten Morgen noch lesenswert, wenn die Nachricht schon längst durch das Internet bekannt geworden ist. Die Tageszeitung ist also nur noch dann überlebensfähig, wenn sie mit der reinen Abbildung von
Ereignissen aufhört und die Form ihrer Berichterstattung neu denkt. Ein weiterer denkbarer Ansatz wäre der Umstieg auf Wochenend-, Wochen- oder Monatszeitungen, die die Themen der Woche bzw. eines Monats beleuchten, umfangreicher daherkommen und zugleich dann gelesen werden, wenn die Leserschaft vergleichsweise am meisten
Zeit hat – am Wochenende eben. Das zeigt somit, dass die Erscheinungsintervalle von Zeitungen überdacht
werden müssen und vermutlich nur dann eine ökonomisch sinnvolle Existenz gewährleistet werden kann.
Oder sind solche Nachrichtenportale und gedruckten Zeitungen überflüssig und gänzlich durch andere Publikationskanäle ersetzbar? Sind Blogs eine ernstzunehmende Alternative? Im Rahmen der Debatte um die Zukunft von Zeitungen und Journalismus wird genau darüber nachgedacht. Blogs sind längst in der medialen Landschaft etabliert und ein beliebtes Medium, das Autor und Leserschaft auf Augenhöhe kommunizieren lässt. BloggerInnen machen Inhalte mindestens genauso greifbar und tragen erheblich zur Meinungsbildung bei. Doch auch hier steht die Frage der Finanzierung und Qualität von Texten im Raum. In den wenigsten Fällen kann ein privat betriebener Blog aktuellen und qualitativ hochwertigen Inhalt zugleich bieten, weil die Menschen dahinter eben keine bezahlten JournalistInnen sind. Vereinzelt werden BloggerInnen bereits heute von ihrer Leserschaft oder Unternehmen finanziert, wobei sie durch letztere Finanzierung unglaubwürdig werden. Natürlich könnten nun alle Beschäftigten einer Zeitung ihren eigenen Blog online stellen und auf finanzielle Unterstützung hoffen, was kaum passieren wird. Wenn sich selbst namhafte Zeitungen mit großer Leserschaft so nicht finanzieren können, werden dieses vereinzelte Gesichter wohl kaum leichter haben.
Man kann also nur darüber spekulieren, ob und wann die (gedruckte) Zeitung ihren Todestag haben wird. Des Weiteren wird sich in den nächsten Jahren zeigen, welches Erscheinungsintervall sich durchsetzen kann und zugleich müssen wir unsere Zahlbereitschaft für kostenlose Inhalte überdenken. Eine Gesellschaft ohne einen vielseitigen Zeitungsmarkt ist unvorstellbar, weil dieses Medium gute Ideen, Recherchen und Meinungen vereint.
Also lege ich weiterhin die Zeitung auf das Kassenband – schließlich kosten gute Dinge oft auch gutes Geld. Egal, ob gedruckt oder digital.
Bildquelle Artikelbild oben: „Newspapers“ von Alex Barth unter der Lizenz CC BY 2.0 via Flickr
Quellen:
[1] Aktuelle Reichweiten – die-zeitungen.de (24.08.2013 17:00)
[2] Menschen, die auf Schirme starren – Spiegel Online (24.08.2013 17:16)
[3] Repplinger, Roger: Wenn das Totenglöcklein bimmelt, in: Kontext: Wochenzeitung (2013), Nr. 125, S. 1
[4] Extrabyte! Extrabyte! – derFreitag (24.08.2013 20:43)
[5] Springer-Strategie: Journalismus im Schlussverkauf – Spiegel Online (25.08.2013 00:48)
[6] siehe [3]
[7] Sportwerbung: taz setzt Verpixelung aus – taz.blogs (24.08.2013 23:33)
[8] Bull-Analyse: Die Auflage der taz steigt – taz.blogs (24.08.2013 23:43)
[9] „Werbung aus“ – derFreitag (24.08.2013 23:50)
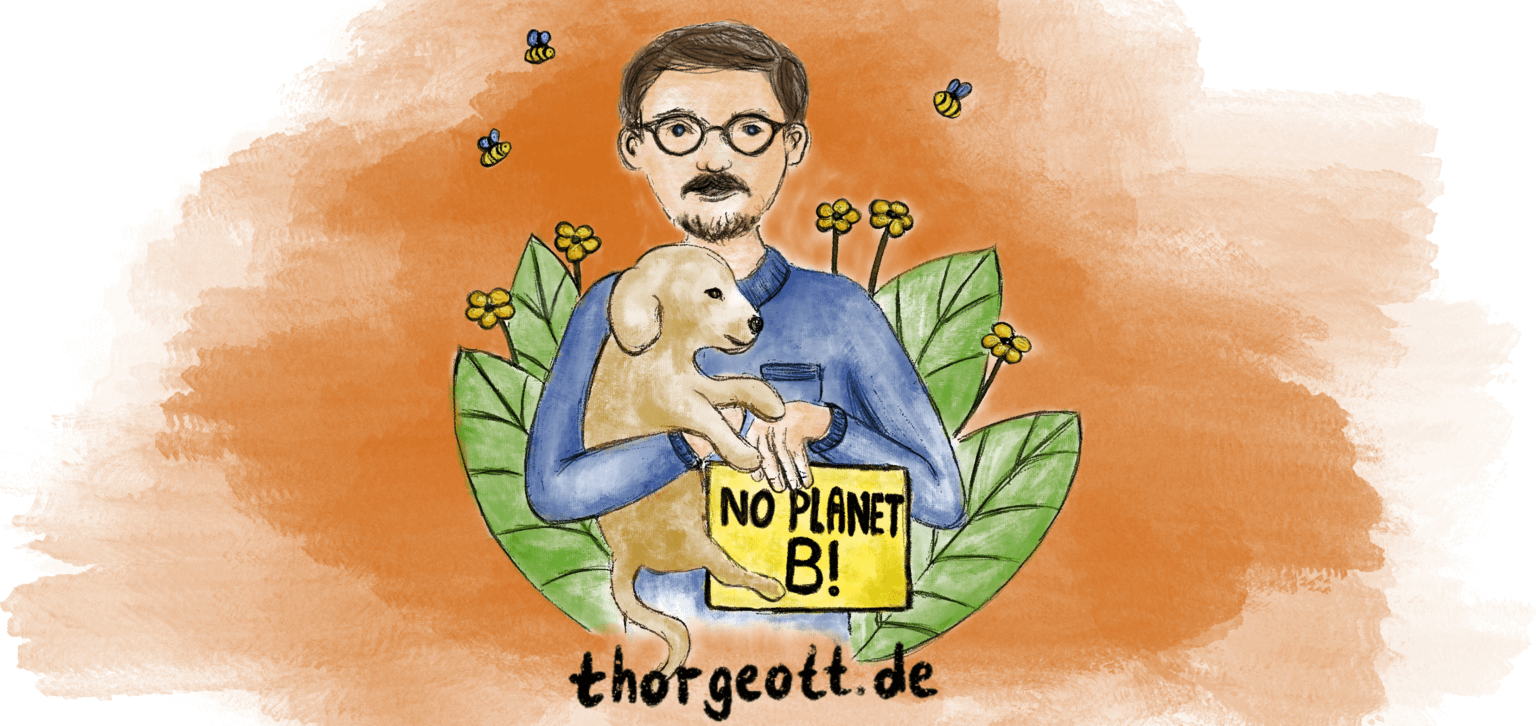

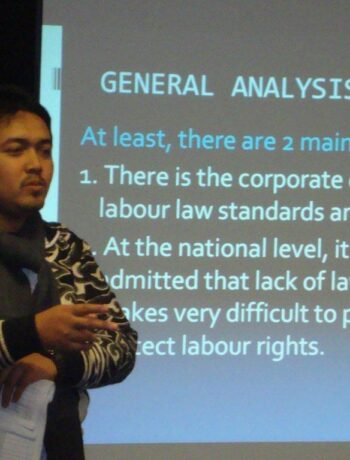


Keine Kommentare